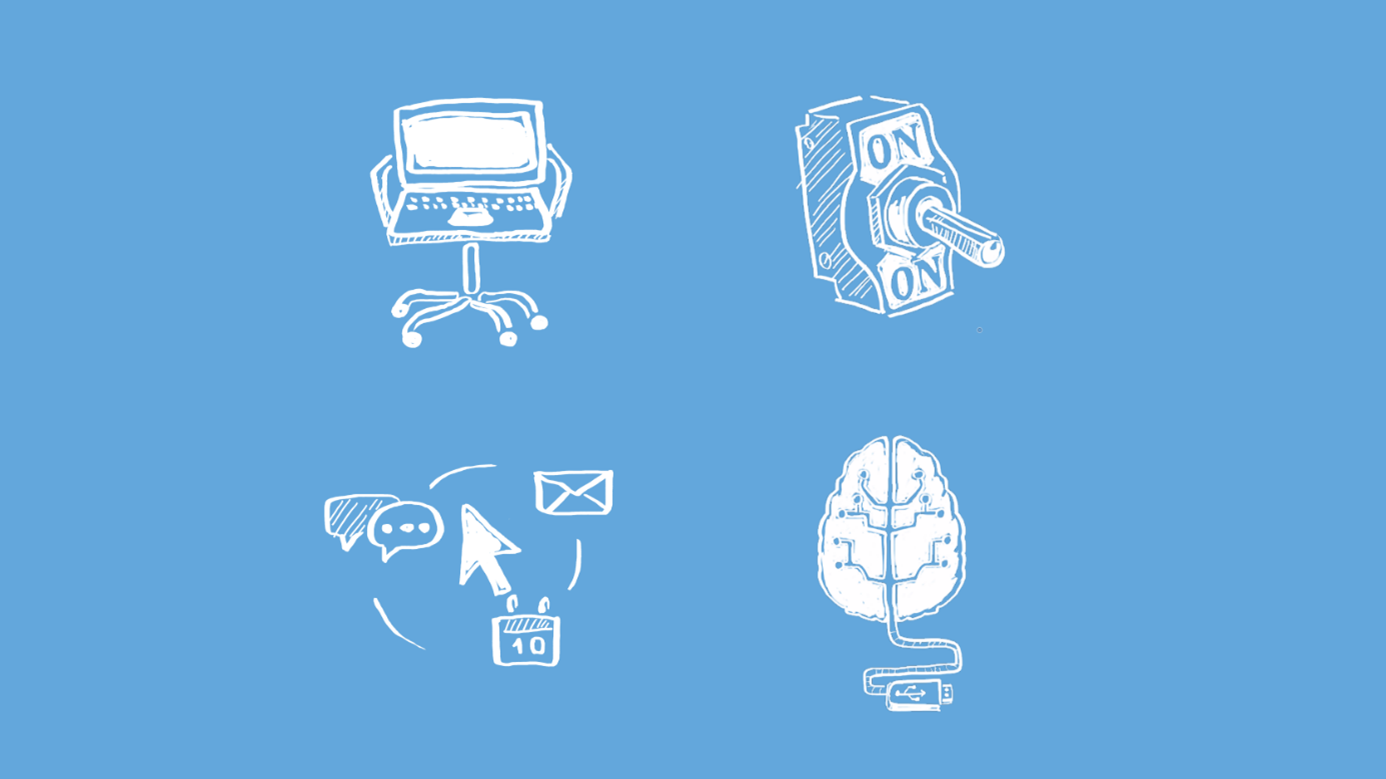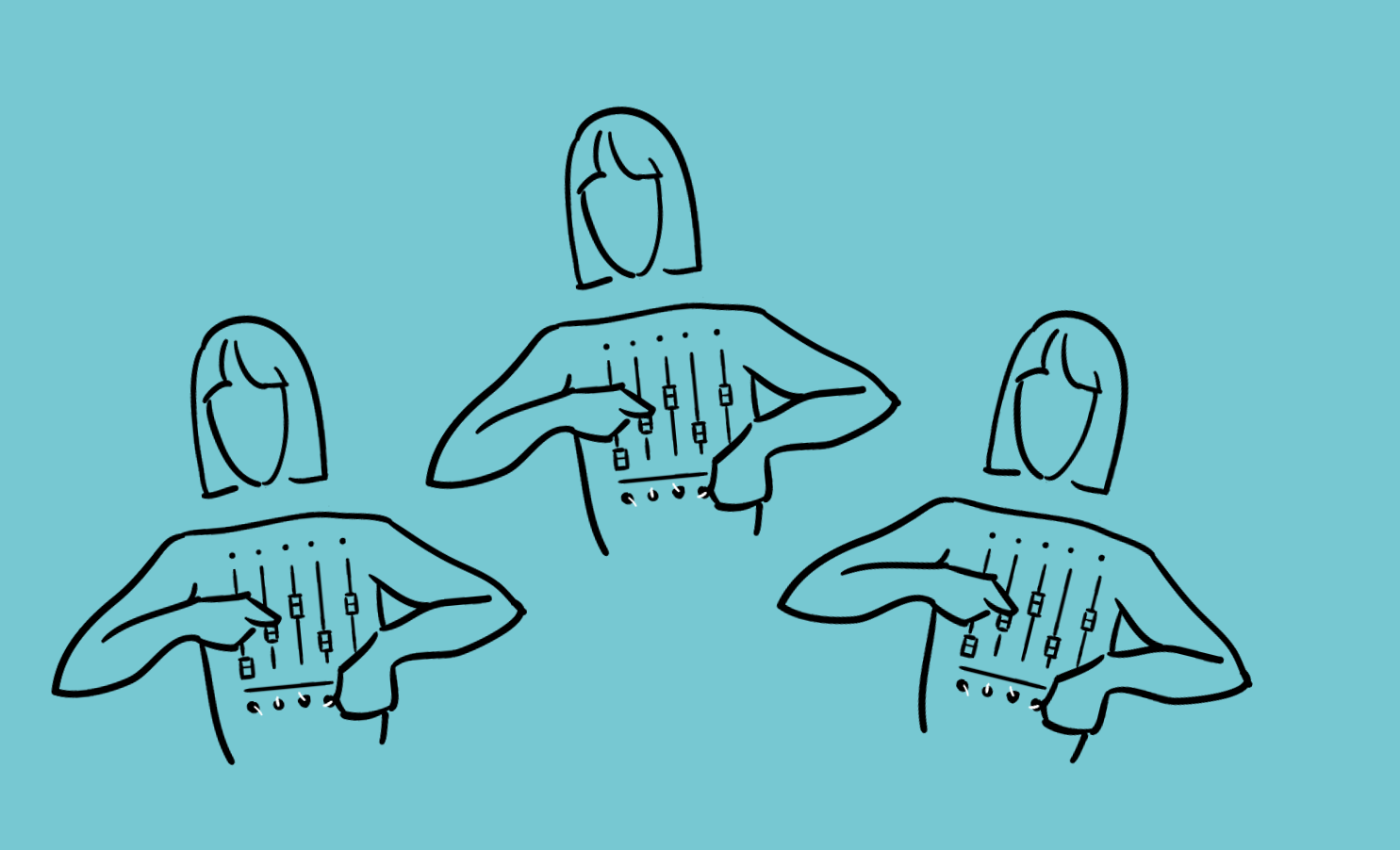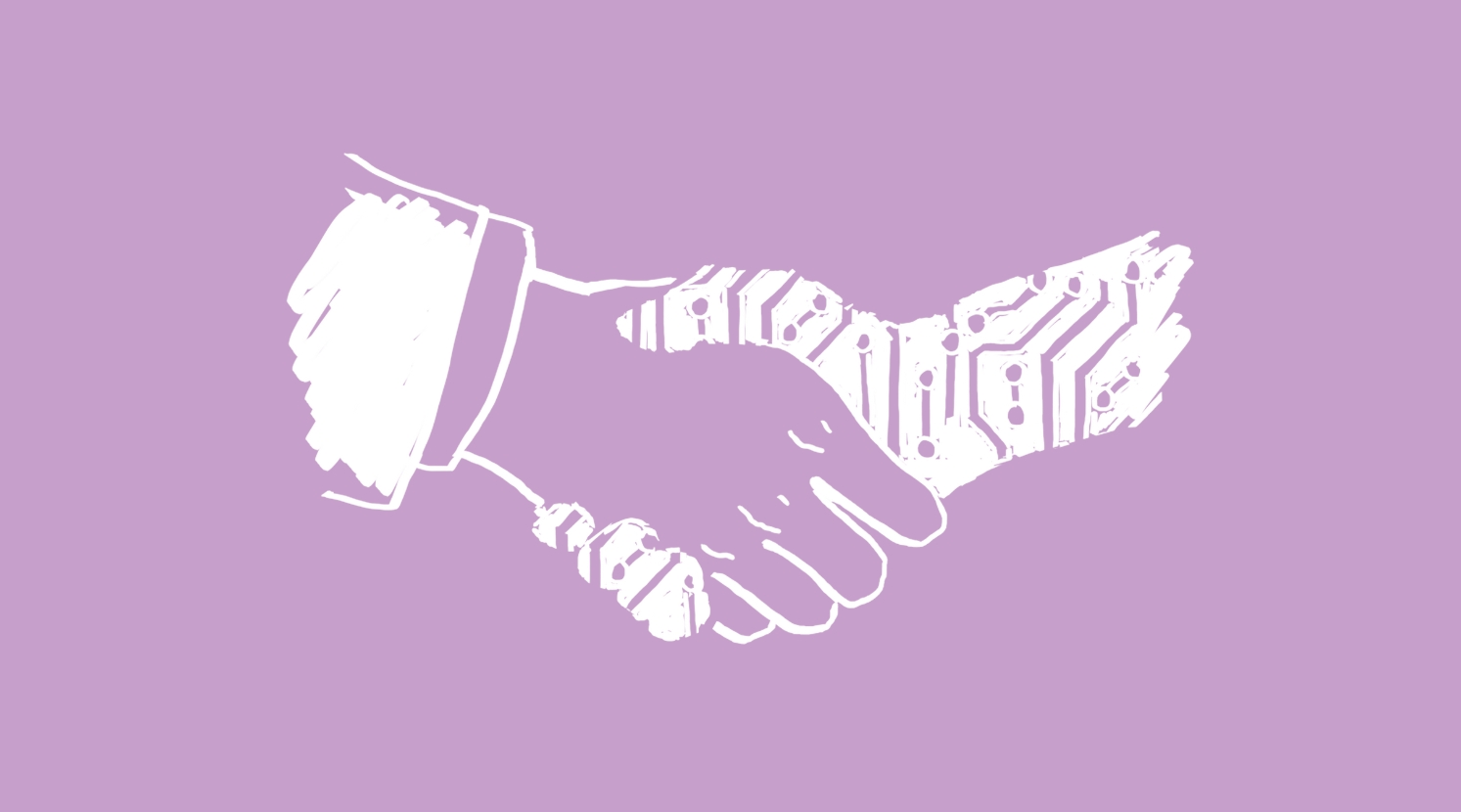
IAP-Studie: «Generative KI wird als Chance wahrgenommen»
Die generative künstliche Intelligenz wird in der Arbeitswelt bereits sehr oft eingesetzt: bei der Arbeit mit Texten oder um Ideen zu finden und für die Recherche. Für die User:innen überwiegen dabei die positiven Effekte. Nachholbedarf gibt es jedoch bei der Regulierung und Offenlegung. Das sind einige der Ergebnisse der neusten Studie des IAP Institut für […]