ChatGPT & Nachhaltigkeit: Vom Prompt zum Klimasünder: Wir alle wollen nachhaltiger leben – im Alltag, beim Einkaufen, im Hörsaal und im Büro. Auch die Schweiz hat sich mit den Klimazielen viel vorgenommen. Doch während wir bewusst CO₂ einsparen, wächst unser digitaler Fussabdruck oft unbemerkt. Auch der neueste Trend auf LinkedIn – der eigene Avatar als Actionfigur in Blisterverpackung – trägt zur digitalen Überhitzung bei.
Ein Gastbeitrag von David Bachetti und Thomas Bigliel
Geschätzte Lesedauer: 8 Minuten

Digitale Actionfigur: Trend mit Schattenseite
The Apprentice-TV-Star und Mission-Good-Gründerin Jenny Garbis war eine der ersten Stimmen, die das scheinbar harmlose Social-Media-Phänomen rund um digitale Actionfiguren in Blisterverpackungen öffentlich hinterfragte.
Von DALL·E zum perfekten Bild: Ein technischer Sprung
Wer noch vor ein paar Wochen mit DALL·E – dem Bildgenerator von ChatGPT – experimentierte, erhielt nicht selten kuriose Ergebnisse: wirre Buchstabengebilde, Texte wie aus einem Fiebertraum, Menschen mit sechs Fingern und puppenhaften Gesichtern. KI-generierte Bilder waren bisher einfach zu erkennen. Sie waren oftmals nicht oder eben ein bisschen zu perfekt. Zumindest bis vor wenigen Tagen.
GPT-4o: Ein Prompt genügt – und die Bilderflut beginnt
Letzten Monat hat OpenAI die nächste Stufe gezündet: ChatGPT verfügt nun über eine direkt integrierte Bildfunktion, die DALL·E offiziell in den Ruhestand schickt. Das neue GPT-4o Modell erzeugt fotorealistische Bilder, verarbeitet komplexe Inhalte, bettet Texte präzise ein – und das alles auf Knopfdruck. Kein separates Tool mehr, kein kompliziertes Interface. Ein Prompt genügt.
LinkedIn als Bühne: Digitale Selbstinszenierung in Serie
Und genau das reicht offenbar auch, um einen Trend auszulösen: Actionfiguren von sich selbst, digital gerendert und in Blisterverpackungen gepresst, überschwemmten innerhalb von kurzer Zeit das Karrierenetzwerk LinkedIn und tun es immer noch. Zwischen Jobupdate und Buzzword-Post taucht plötzlich der eigene Avatar auf – mit Jobtitel und Slogan. Ein Ausdruck digitaler Selbstinszenierung – mit hohem Unterhaltungswert, aber auch ökologischem Preis.
Was kostet ein Prompt? Mehr als wir denken
Ghibli-Style: KI trifft auf japanische Ästhetik
Neben den Actionfiguren in Blisterverpackung zeichneten sich in den letzten Tagen noch weitere Trends ab. Besonders beliebt war dabei auch der Stil des berühmten japanischen Animationsstudios Ghibli. Innerhalb weniger Tage fluteten vermeintliche Ghibli-Porträts das Netz – generiert von GPT-4o, gepostet auf LinkedIn, Instagram und TikTok. Der Wiedererkennungswert ist hoch: weiche Farbverläufe, pastellfarbene Landschaften, ausdrucksvolle Anime-Augen. Statt Businessfotos tauchten plötzlich KI-Versionen von «Mein Nachbar Totoro» und «Chihiros Reise ins Zauberland» in den Karrierenetzwerken auf.
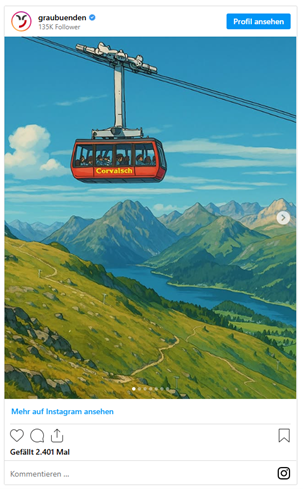
Graubünden im Ghibli-Stil
Die User:innen machten sich einen Spass daraus, berühmte Memes, Selfies und Werbemotive durch den Ghibli-Filter zu jagen. Auch der derzeit wegen seiner Handelszölle in Kritik stehende US-Präsident blieb vom Trend nicht verschont. Innerhalb weniger Tage entwickelte sich der ästhetisch entschleunigte Stil zu einem viralen Social-Media-Trend. Auch Unternehmen – ja, sogar Kantone – sprangen auf: «So sieht der Sommer in Graubünden im Ghibli-Stil aus», warb etwa Graubünden Tourismus. Es dauerte nicht lange, bis die Kritik aufkam: «Graubünden braucht keine KI, um attraktiv zu sein“, kommentierte ein Insta-Nutzer. Und trifft damit den Punkt.
OpenAIs neues Sora-Modell kann beliebige Inhalte im Stil von Studio Ghibli darstellen – was auf X (und anderen Social Media Kanälen) viral ging.
Youtube Beitrag dazu.
Unsichtbare Maschinen, spürbare Folgen
Denn was viele vergessen: Hinter jedem generierten Bild, jedem Prompt, jedem kleinen Chat mit der KI laufen Hochleistungsrechner. Nicht irgendwo in der digitalen Cloud, sondern in Rechenzentren mit realem Stromverbrauch – oft gespeist durch fossile Energie. Und das hat Folgen.
Emissionen pro Prompt: Kleiner Impuls, grosse Wirkung
Erste Schätzungen sprechen von 4.32 Gramm CO₂ pro ChatGPT-Anfrage. Harmlos? Nur auf den ersten Blick. Denn mit weltweit über 50 Millionen täglichen Nutzer:innen und mehreren Milliarden Prompts im Monat entstehen Emissionen, die alles andere als virtuell sind.
30’000 GPUs – und 43 Tonnen CO₂ täglich
Allein der Betrieb der Infrastruktur – laut Schätzungen rund 30’000 GPUs täglich – verursacht täglich bis zu 43 Tonnen CO₂. Zum Vergleich: Das entspricht den Emissionen von rund 3’500 durchschnittlichen Autofahrten pro Tag. Und das ist noch konservativ gerechnet.
Digitaler Durst: Der Wasser-Fussabdruck der KI
Wasserverbrauch im Training von KI-Modellen
Dabei ist es nicht nur die Rechenleistung, die Ressourcen frisst. Auch der Wasserverbrauch ist enorm: Das Training eines einzigen KI-Modells wie ChatGPT kann so viel Wasser benötigen wie etwa die Produktion von 370 BMWs oder 320 Teslas. Das ergab eine Studie der University of California, Riverside (Ren et al., 2023), die den bislang wenig beachteten Wasser-Fussabdruck grosser KI-Systeme offengelegt hat.
Kühlung frisst Ressourcen: Zahlen aus dem MIT
Auch andere Forscher:innen blasen ins selbe Horn: In einem Bericht vom Januar 2025 schreiben Forschende des Massachusetts Institute of Technology (MIT), dass moderne KI-Modelle wie GPT-4 beim Training und Einsatz nicht nur riesige Mengen Strom, sondern auch Unmengen an Wasser für die Kühlung der energiehungrigen GPUs benötigen – oft mehrere Liter pro Kilowattstunde. Hochgerechnet könnte der globale Wasserbedarf durch KI bis 2027 mehrere Milliarden Kubikmeter pro Jahr erreichen – mehr als der gesamte Wasserverbrauch von Dänemark.
Energieverbrauch im Alltag – und der blinde Fleck
Und auch nach dem Training ist der Energiehunger nicht vorbei: Eine einfache ChatGPT-Anfrage verbraucht rund fünfmal mehr Strom als eine klassische Websuche. Doch das Bewusstsein dafür fehlt. «Just because this is called ‘cloud computing’ doesn’t mean the hardware lives in the cloud.», kommentiert MIT-Forscher Noman Bashir in einem vielbeachteten Artikel die Situation. Und er hat recht: Denn während in der SRF-Arena die politische Debatte um CO₂-Ziele, Gebäudesanierungen und Heizsysteme tobt, ist die digitale Infrastruktur längst zum blinden Fleck der Nachhaltigkeit geworden.
Green Computing: Zwischen Anspruch und Realität
Der Begriff des sog. Green Computings geistert zwar seit Jahren durch Strategie-Papiere und Innovationspanels. Doch auch, wenn sich Unternehmen, die Kantone und der Bund für das Thema interessieren: Konkret passiert ist wenig. Dabei wäre es höchste Zeit, die Rechenzentren dieser Welt – und in der Schweiz – nicht nur effizienter, sondern wirklich nachhaltig zu betreiben: mit nachweisbar erneuerbarem Strom, intelligenter Lastverteilung und klaren Emissionsstandards.
Strommix, Cloud und blinde Flecken der Nachhaltigkeit
Stattdessen werden KI-Anfragen rund um die Uhr durch Hochleistungsanlagen geschleust – ohne Transparenz für die Nutzer:innen und ohne wirkliche gesellschaftliche Debatte. Zugegeben: In der Schweiz stammt der grösste Teil des Stroms aus Wasserkraft. Doch auch hierzulande wird weiterhin ein nicht unerheblicher Anteil durch Gas-, Öl- oder Kehrichtverbrennungsanlagen gedeckt – insbesondere in Spitzenzeiten. Und Strom, der für KI-Anwendungen importiert oder via Cloud-Dienstleister bezogen wird, stammt nicht zwingend aus heimischer Produktion. Nachhaltigkeit hört eben nicht an der Landesgrenze auf – und schon gar nicht am Server Rack.
Grüner Code, bessere Rankings
Webdesign als Klimafaktor
Doch nicht nur Server, auch das Webdesign trägt seinen Teil zur digitalen Überhitzung bei. Viele Websites sind zu schwer, zu verspielt, zu datenhungrig. Überladene Startseiten, Autoplay-Videos, aus Usability-Sicht unnötige Animationen – all das frisst Bandbreite, Speicherplatz und Strom. Dabei wäre es einfach: Reduktion statt Effekt. Klare Strukturen, schlanker Code, gezielte Bildoptimierung. Die Möglichkeiten sind vorhanden.
Green UX: Nachhaltigkeit trifft Sichtbarkeit
Nachhaltiges Webdesign heisst: Ladezeiten senken, Ressourcen schonen, Nutzer:innenführung vereinfachen – und nebenbei auch Google gefallen. Denn schnell ladende, schlank programmierte und besser strukturierte Seiten schneiden nicht nur ökologisch besser ab, sondern auch in der Suchmaschinenoptimierung (SEO): bessere Rankings, geringere Absprungraten, höhere Sichtbarkeit. Wer grün denkt, wird also auch online öfter gefunden.
«Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung sind die neuen Werte des 21. Jahrhunderts, und Designer müssen sie in jedes Projekt integrieren», fasst Unternehmer und Industriedesigner Yves Béhar treffend zusammen.
Gerade für Unternehmen in der Schweiz – mit Fokus auf Qualität, Nachhaltigkeit und Innovationskraft – wird das sog. Green UX zur strategischen Chance. Wer digital nachhaltig denkt, wird nicht nur häufiger gefunden – sondern auch glaubwürdiger wahrgenommen.
Zu den Gast-Autoren:
David Bachetti ist Absolvent des ZHAW-CAS Advanced Digital Marketing. Zusammen mit Thomas Bigliel, der an der ZHAW im MAS Business Administration als Gastdozent zum Thema strategisches Marketingmanagement unterrichtet, leitet er die Zürcher Online Marketing Agentur – Agent AGENTUR. Die Full-Service Webagentur hat sich schwerpunktmässig auf Online Marketing, Webdesign & Webentwicklung, SEO und Google Ads spezialisiert