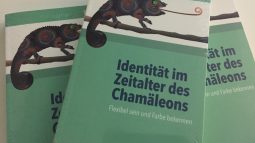Als Leader und Entrepreneur unterwegs in Sri Lanka
Im CAS International Leader & Entrepreneur lernen die Teilnehmenden, wie sie ihre Unternehmens- und Führungskompetenzen stärken und gleichzeitig ein soziales Unternehmen in Asien auf die Beine stellen können. Wie das funktioniert, und welche Hürden sie dabei überwinden müssen, erzählt die Dozentin Stefanie Neumann in diesem mehrteiligen CAS-Journal. Von Stefanie Neumann, Dozentin und Beraterin am IAP […]