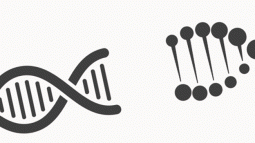Von unseren Eltern erben wir mehr als nur ihre Gene. Eine Mutter kann auch körperlichen oder psychischen Stress, den sie während der Schwangerschaft erlebt, an ihr Kind weitergeben. Dafür verantwortlich sind epigenetische Prägungen.
VON MICHAEL BACHMANN
Im Zweiten Weltkrieg blockierten die Nazis sämtliche Transporte von Nahrungsmitteln in die Niederlande. So litten im Winter 1944 über 4,5 Millionen Menschen Hunger – darunter Tausende von schwangeren Frauen. Sie mussten mit weniger als 800 Kilokalorien pro Tag durchkommen. Das ist nicht einmal ein Drittel des Tagesbedarfs einer Schwangeren. Dieser Mangel hinterliess Spuren bei den ungeborenen Babys. Die meisten von ihnen waren bei der Geburt zu klein und zu leicht. Und heute, im Erwachsenenalter, leiden sie auffällig häufiger an gesundheitlichen Beschwerden als ihre Geschwister, die vor oder nach ihnen zur Welt kamen, etwa an Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Stoffwechselkrankheiten. Das zeigen mehrere Untersuchungen internationaler Forschungsgruppen. Ein Ergebnis aber liess die Wissenschaftler besonders aufhorchen: Brachten die Kinder des Hungerwinters später selber Babys zur Welt, waren auch diese untergewichtig – ungeachtet der Zeit des heutigen Überflusses. Fast schien es, als hätten die Grossmütter das Leid des Weltkriegs über zwei Generationen hinweg an ihre Enkel weitervererbt.
Diabetes als Folge eines Sturms
Der Schluss ist nicht ganz falsch. Allerdings erfolgte die Vererbung dieses Traumas nicht direkt über das Erbgut. Vielmehr fanden Wissenschaftler bei den Kindern des Hungerwinters subtile chemische Veränderungen an der Oberfläche der Erbsubstanz: Bei bestimmten Genen fehlten sogenannte Methylierungen, wie eine Studie holländischer und amerikanischer Biologen aus dem Jahr 2008 zeigt. Diese Methylierungen bestehen aus wenigen Kohlenstoff- und Wasserstoffatomen, die sich an den DNA-Strang anheften. Je nachdem, an welchen Stellen und mit welcher Häufigkeit das geschieht, werden einzelne Gene ein- oder ausgeschaltet. Die Summe dieser chemischen Veränderungen des Erbguts bezeichnet man als Epigenom (siehe Box).
In den letzten Jahrzehnten gab es immer wieder Aufsehen erregende Studien, aus denen hervorgeht, dass Mütter ihren Kindern tatsächlich gewisse epigenetische Prägungen weitergeben können. Wiederholt wurde gezeigt, dass sich nicht nur lebensbedrohliche Mangelernährung im Epigenom der Kinder niederschlägt, sondern auch Stress. Das «Project Ice Storm» beispielsweise untersucht kanadische Kinder, die im Januar 1998 im Bauch ihrer Mütter heranwuchsen. Zu dieser Zeit fegten mehrere Stürme über Quebec und bedeckten die Stromleitungen mit einer dicken Eisschicht. Drei Millionen Menschen mussten ohne Strom auskommen – und zwar während sechs Wochen. Für die damals schwangeren Frauen ein grosser Stress, dessen Folgen ihre Kinder heute, zwanzig Jahre später, spüren: Sie leiden deutlich häufiger an Übergewicht, Diabetes, Asthma und Autismus als Kinder anderer Jahrgänge. Und auch bei diesen Kindern findet man ein verändertes epigenetisches Muster.
Risikofaktoren werden zu wenig erfasst
Wie viel Stress braucht es denn, damit sich das epigenetische Muster eines Kindes während der Schwangerschaft dauerhaft verändert? «Das ist schwierig zu fassen», sagt Susanne Grylka, stellvertretende Leiterin der Forschungsstelle Hebammenwissenschaften am Departement Gesundheit der ZHAW. «Die Schwangerschaft bringt ein gewisses Stresslevel einfach mit sich.» Das gelte vor allem für jene Frauen, die zum ersten Mal Mutter werden. «Oft verändert sich mit der bevorstehenden Geburt ihr gesamtes Leben», sagt Grylka, die 26 Jahre als praktizierende Hebamme gearbeitet hat. Etwa durch den Umzug in eine grössere Wohnung, knappere finanzielle Verhältnisse oder die veränderte Beziehung zum Mann. «Das alleine ist aber keine Katastrophe für das Kind», sagt Grylka. Erst wenn sich der Stress über längere Zeit akkumuliere oder wenn schwere äussere Einflüsse wie während des Hungerwinters oder des Eissturmes hinzukämen, könne er sich negativ auf das Kind auswirken.
Zudem empfindet nicht jede Frau dieselben Situationen als Stress. «Für die einen Frauen sind die körperlichen Veränderungen während der Schwangerschaft sehr schön – für andere dagegen sehr belastend», sagt die Forscherin. Die meisten werdenden Mütter bräuchten aber keine häufigeren Schwangerschaftskontrollen. Die körperlichen Risikofaktoren würden heute bereits gut überwacht.
Stress zu erkennen braucht mehr Zeit
Um aber psychische Belastungen und Stress zu erkennen, bräuchte es entweder die Anwendung spezieller Fragebögen oder vertiefte Gespräche. «Dafür reichen die durchschnittlich 15 Minuten Konsultationszeit pro Frau in den ärztlichen Schwangerschaftskontrollen aber schlicht nicht aus», sagt Grylka. «Eine Schwangerschaftsvorsorge durch Hebammen böte diesbezüglich Vorteile.» Denn die Hebammen können sich während einer Schwangerschaftsbegleitung deutlich mehr Zeit für die Frauen nehmen. Dieses Angebot könne noch stärker genutzt werden, sagt Grylka. «Neben den mit der Schwangerschaft verbundenen medizinischen Themen kämen so auch der emotionale Zustand und das Wohlbefinden der Frauen nicht zu kurz». //
ZELLEN IGNORIEREN EINEN TEIL DES ERBGUTS
Der menschliche Körper besteht aus einer Vielzahl spezialisierter Zelltypen: Nervenzellen, Hautzellen, Leberzellen, Muskelzellen und viele weitere. Das Aussehen und die Funktionsweise all dieser Zellen sind völlig verschieden – und trotzdem tragen alle genau dasselbe Erbgut (Genom) in sich. Wie können sie sich mit derselben Information so verschieden entwickeln? Das Geheimnis liegt darin, dass jeder Zelltyp nur bestimmte Gene beachtet, andere Abschnitte des Genoms aber komplett ignoriert. Man kann sich das Genom als ein Buch vorstellen, aus dem Herzmuskelzellen nur das Kapitel über das Herz lesen und Nervenzellen nur jenes über das Gehirn. Unter Epigenetik versteht man die Mechanismen, die dazu führen, dass Gene von einer Zelle stärker oder schwächer abgelesen werden. Verantwortlich dafür, welche Kapitel des Buches oder eben Gene für die verschiedenen Zelltypen sichtbar sind, ist das Epigenom. Dieses kann von einer Zelle auf ihre Nachkommen weitervererbt werden. Aus diesem Grund wird aus einer Nervenzelle nicht plötzlich eine Muskelzelle. Wie genau diese Vererbung passiert, ist noch nicht restlos geklärt. Sicher ist, dass es Enzyme gibt, die epigenetische Merkmale gezielt an der DNA anbringen oder entfernen können.
Das 5. Winterthurer Hebammensymposium
«Epigenetik – Mama ist an allem schuld?»
Was die Erkenntnisse der Epigenetik für die Ausbildung und den Berufsalltag bedeuten, erfahren Interessierte am 5. Winterthurer Hebammensymposium, das vom Institut für Hebammen des Departements Gesundheit organisiert wird.
Samstag, 19. Januar 2019
«Vitamin G», Seite 14-15
WEITERE INFORMATIONEN
- Epigenetik zwischen den Generationen: Forschung am Max-Planck-Institut für Immunbiologie und Epigenetik in Freiburg
- Youtube-Video zur Epigenetik – Änderungen jenseits des genetischen Codes
- Epigenetik auf Wikipedia