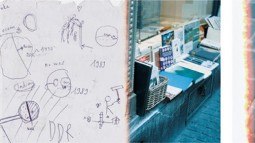Die Eisbrecherin
Sandra Nast hat 2016 den Master in Organisationskommunikation an der ZHAW abgeschlossen und unterrichtet heute minderjährige Asylsuchende in Bern. Warum ihr die interkulturelle Kommunikation am Herzen liegt und welche Erkenntnisse aus dem Studium ihr im Berufsalltag am meisten helfen – darüber sprach sie mit ihrem ehemaligen Kommilitonen Christopher Onuoha. von Christopher Onuoha, Mitarbeiter Kommunikation und […]