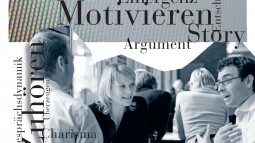„Vertrauen ist die neue Währung“
Communities werden für Unternehmen weltweit immer wichtiger. Doch wie schaffe ich es, eine Community aufzubauen, welche der Firma auch den erhofften Nutzen bringt? Der letzte Event von Columni, der Ehemaligenorganisation des IAM, gab Antworten. von Andreas Engel, Redaktor Alumni ZHAW Das Internet als Informations- und Dialogquelle ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Ob Google als […]