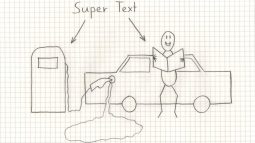Viel Neues im Osten: Schweizer Journalismuspioniere 2.0
von Mirco Saner, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungsschwerpunkt Journalistik des IAM Heutige Jahresabonnemente für Tageszeitungen sind zu teuer, sagte Tamedia-Verwaltungsratspräsident Pietro Supino kürzlich am JournalismusTag.16 in Winterthur. Realistisch sei, dass Kunden künftig zwischen 200 und 400 Franken dafür bezahlen würden. Schlechte Aussichten für Tages-Anzeiger, Berner Zeitung, 24 Heures und Co., deren Abos derzeit zwischen 460 und […]