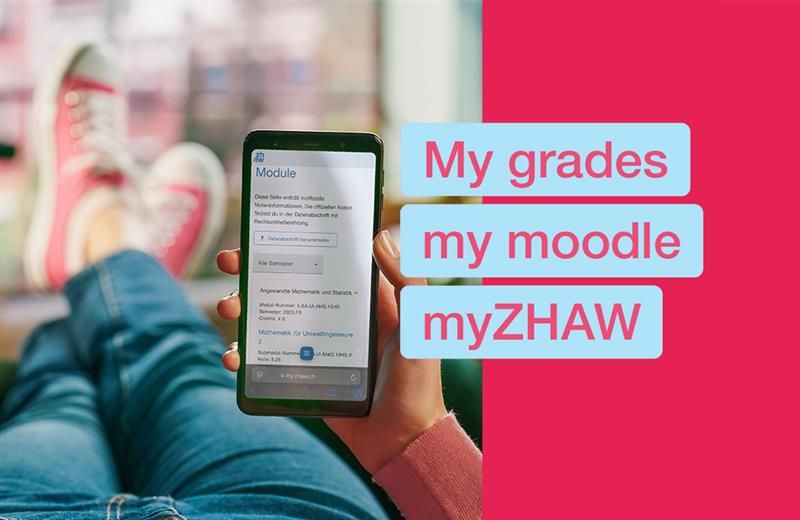Treibt Sie auch die Frage um, wie wir die disruptive Kraft der Digitalisierung an Hochschulen nicht nur verwalten, sondern für unsere Kernmission nutzbar machen können? Eine ungewöhnliche, aber erhellende Parallele finden wir in der Welt des Laufsports mit ihren Hightech-Schuhen. Tauchen Sie mit uns ein in eine sportliche Betrachtung der digitalen Transformation und entdecken Sie drei konkrete Handlungs- bzw. Lauffelder für die Hochschulbildung.
Ein Beitrag von Patrick Hunger
Häufiger und härter trainieren
Die Laufdisziplinen erfahren eine spektakuläre Beschleunigung. Als (Mit-)Ursache dafür gelten sogenannte «Super Shoes». Super Shoes sind Laufschuhe, in deren Sohlen hochreaktiver Schaum mit einer Carbonplatte kombiniert werden, was einen Katapulteffekt bewirkt. Diese Beschleunigung widerspiegelt sich nicht nur im Wettkampf, sondern auch in der Regenerationszeit, da die Ermüdung des Bewegungsapparates (durch die Dämpfung) reduziert wird. Gleichzeitig erhöhen sich die körperlichen Stressreaktionen durch erzwungene Bewegungsänderungen und das Verletzungsrisiko nimmt zu. Doch was hat das mit Hochschulbildung und digitaler Transformation zu tun?
Educative Carbonplatten
Super Shoes revolutionieren den Sport nicht durch eine Neuerfindung des Laufens, sondern durch eine optimierte Schnittstelle zwischen Athlet:in und Strecke. Die Leistungssteigerung resultiert aus der intelligenten Symbiose von menschlichem Potenzial und technologischem Fortschritt.
Gleichartig verändert die digitale Transformation die Hochschulbildung: Unsere Leistungsbereiche, insbesondere Lehre und Forschung, werden nicht neu geschaffen. Vielmehr wandeln sich die „Schnittstellen“ durch die digitale Transformation radikal. Digitale Werkzeuge, adaptive Lernplattformen oder datengestützte Didaktik wirken wie educative Carbonplatten: Sie optimieren und innovieren Zugang, Effizienz und individuelle Förderung in der hochschulischen Leistungserbringung. Sie wirken als Katalysatoren für das Ausreizen allen Hochschulakteuren inhärenten und durch Technologie auffallend beliebig individualisierbaren Potenzials (vgl. zur Veränderungsdynamik generativer KI bspw. den Beitrag «Zwei Perspektiven auf Generative KI: Lehren und Lernen am Institut für Facility Management»).

Technologie als Enabler der akademischen Kernmission
Diese Transformation ist keine blosse (finanzielle) Anschaffungsfrage, sondern erfordert ein fundamentales Organisations- und Technologieverständnis. Die Hochschule muss sich vom reinen Lern- zum lernenden Ökosystem wandeln (vgl. hierzu bspw. auch den Beitrag «Organisationale Entwicklung und Alleinstellung in der Hochschulbildung»). Die Integration bzw. Nutzbarmachung dieser neuen „Schnittstellen“ betrifft die gesamte Institution: von der IT-Infrastruktur und Didaktik über Fortbildungskonzepte bis hin zu Anreizsystemen für Lehrende. Die grösste Herausforderung ist kulturell: Die Akzeptanz von Technologie als Enabler der akademischen Kernmission muss reifen. Technologie ist auch in einem reflektiert kritischen Dialog nicht primär eine Bedrohung für Hochschulen, sondern Beziehung. Auch die Läuferin muss sich mit Super Shoes an den Füssen gut fühlen bzw. mit ihnen wechselseitig verbunden sein.
Wie soll die Hochschule diese Transformation gestalten?
- Laufstrategie statt DNF («Did not Finish»):
Handlungsbedarf: Es bedarf einer hochschulweiten Digitalisierungsstrategie, die von der Hochschulleitung getragen und in alle Bereiche (Lehre, Forschung, Verwaltung) kohärent sowie steuernd übersetzt wird. Vergleichbar mit einer Laufstrategie muss die Hochschule seine Geschwindigkeitszonen kennen und die Intensität bewusst regulieren. Gleichzeitig ist digitale Transformation nicht primär «Race Pace», was in der betrieblichen Übersetzungsleistung bzw. in der Kommunikation der Strategie entscheidend ist: Zu schnell loslaufen können alle!
Beispiel: Mit der strategischen Stossrichtung «Transformativ» nimmt sich die ZHAW in ihrer Strategie dieser Aufgabe an und formuliert Technologie-neutral und aus einer Studierendenperspektive den Soll-Zustand, i.e. die ZHAW bereitet ihre Studierenden auf die Anforderungen und die Erwartungen des Arbeitsmarktes vor und bewirkt positive und nachhaltige Veränderungen für die Gesellschaft. Naturgemäss materialisiert sich dieser intellektuelle Startpunkt ausschliesslich in der operativen Hochschulrealität, d.h. im sprichwörtlichen Laufen. Folgerichtig braucht es kontinuierlich Führungs- und Übersetzungsleistungen auf unterschiedlichen Organisationsstufen (bspw. Strategieumsetzungsprogramme), damit aktiv die organisationalen Geschwindigkeitszonen für die digitale Transformation ausgelotet und die Transformations-Intensität reguliert werden kann. Angemerkt sei, dass Laufleistung bzw. deren Verbesserung das Resultat gezielter Intensitäts-Veränderungen über die Zeit ist (bspw. durch Intervaltraining). Es ist deshalb ratsam, als Organisation nicht einseitig zu trainieren: Super Shoes bringen Rekorde – und mehr Verletzungen oder bezogen auf die Hochschule als Organisation mehr Implementierungsstress, Fehlinvestitionen oder Prozessfragmentierung (was nicht zu verwechseln ist mit erwünschter «Fehlerkultur»). Es ist daher strategisch unerlässlich sich die Wirkung von educativen Carbonplatten bewusst zu machen (z.B. im Kontext von Abschlussarbeiten) und Veränderungen im ‘Training’ einzubauen (in dem bspw. Läufer vermehrt verkehrtherum über die Bahn laufen, damit die Kräfte nicht immer in die gleiche Richtung wirken).
- Lauf-ABC:
Handlungsbedarf: Die wertvollste Investition gilt der Qualifizierung des Personals. „Centers for Teaching and Learning“ müssen zu Innovationslaboren werden, die Dozierende befähigen, die neuen Werkzeuge bzw. educativen Carbonplatten didaktisch kontinuierlich auf die «Ziellinie» (i.e. obige strategische Stossrichtung) auszurichten bzw. gemeinsam mit den Studierenden die Ziellinie zu überqueren (in der Annahme, dass die digitale Transformation immer wieder neue Ziellinien zeichnet).
Beispiel: Mit ihrem GenAI Skills Hub bietet die ZHAW bspw. eine neue Drehscheibe und zentrale Anlaufstelle an, um die AI-Literacy aller Angehörigen der ZHAW zu stärken. Die Plattform soll erfolgreiche und erprobte Inhalte innerhalb der ZHAW teilen und eine Plattform für den Austausch und die Vernetzung bieten. Um tatsächlich schneller beim Laufen zu werden, braucht es hingehen Übung. Analog dem «Lauf-ABC» gilt es auch in der Hochschulbildung bzw. in der Nutzung der educativen Carbonplatten die Koordination zu stärken: Technologie einsetzen kann jeder, die Studierenden sind damit jedoch noch nicht besser auf die Anforderungen und die Erwartungen des Arbeitsmarktes vorbereitet. Folgerichtig erfüllt der erwähnte GenAI Skills Hub nur seinen Zweck, wenn die Mitarbeitenden ihre Erfahrungen diskursiv teilen und das «AI-ABC» (auch gerne in der Laufgruppe) tatsächlich üben, üben, üben …
- Stabilisierungstraining:
Handlungsbedarf: Die Anlehnung an den Laufsport für die Diskussion der digitalen Transformation an Hochschulen zielt im Kern auf die Hochschule als lernende Organisation ab (vgl. hierzu bspw. auch den Blog zu «Zwei Jahre KI-Richtlinie an der ZHAW»). Diese muss sich nicht unausweichlich neu erfinden, sondern ihre strukturellen und kulturellen „Schnittstellen“ kontinuierlich verändern. Die Hochschule orchestriert die Synergie aus menschlicher und technologischer Expertise bzw. Exzellenz, anstatt sie nur als Werkzeug additiv zu verwalten. Diese evolutionäre Anpassungsfähigkeit ist vergleichbar mit dem Stabilisationstraining beim Laufen. Die Hochschule trainiert sich Organisationsspannung (Core Stability), -gleichgewicht, und -muskulatur an. Die Belastung kann damit kontinuierlich erhöht, die eingesetzten educativen Carbonplatten können hierdurch immer höherwertiger, und die bereits beschrieben organisationale Verletzungsgefahr strukturell und bewusst reduziert werden. Voraussetzung ist immerhin, dass diese Optimierung einher geht mit Individualisierung der Veränderung: ‘Fehlbelastungen’ treten bekanntlich bei jeder Läuferin individuell auf.
Beispiel: Mit der an der ZHAW laufenden Diskussion zu KI-basierten Lern- und Tutoring-Systemen lässt sich dies sehr gut illustrieren. Mit dem konkreten Einsatz solcher Systeme im Unterricht und im Bildungsmanagement, mit der kritischen dialogischen Reflexion zu «Bots für Bildung», sowie mit der (Forschungs-)Entwicklung eigener Lösungen übt die ZHAW organisationales Stabilisationstraining. Hierdurch verbessert sich im Ergebnis auch das ZHAW-weite Sourcing solcher Lösungen getreu der Kernfrage: «What type of runner are you»?
Unser Auftrag als Bildungsexpert:innen ist es, die Hochschule als Ganzes für diesen Wandel zu rüsten – damit die Technologie, wie die Carbonplatte im Laufschuh, die menschliche Exzellenz zur vollen Entfaltung bringt. So können Bildungsakteure und besonders die Studierenden und Hochschulmitarbeitenden auf der „Strecke“ ihrer akademischen und professionellen Laufbahn ihre beste Leistung erbringen, und werden im Laufen nicht von der Technologie abgelenkt.
KI-Deklaration:
Die Bilder dieses Beitrags wurde mit DALL·E 3 gerendert.