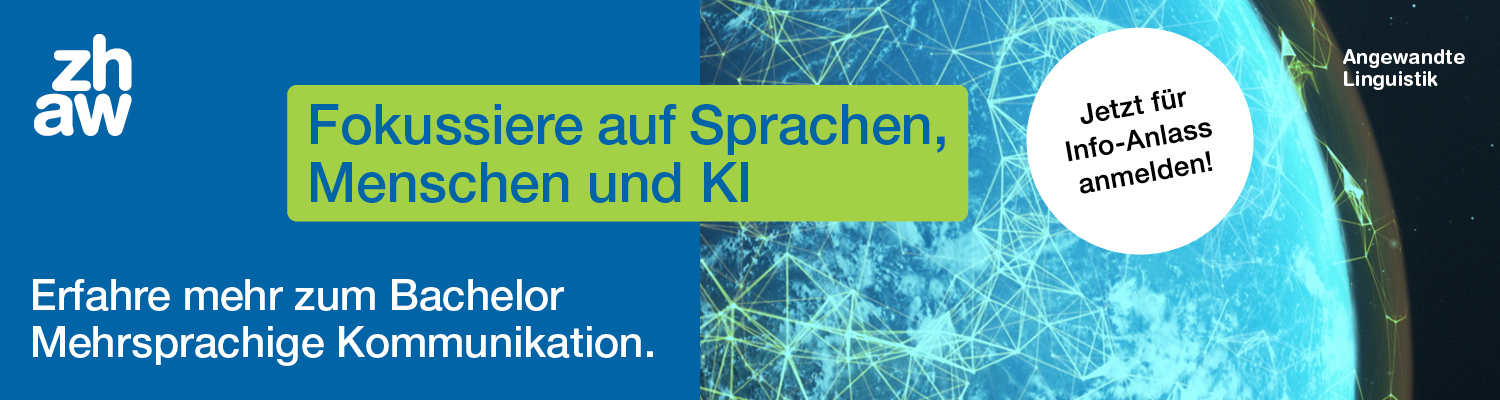Ein Blogbeitrag zur Bachelorarbeit von Toja Rauch
«Wie können wir uns für den Frieden einsetzen, wenn wir uns kaum verstehen?» Diese Frage hat mich über Monate immer wieder begleitet, als ich mich im Sommer 2022 und im Winter 24/25 in einer militärischen Mission im Kosovo befand. In der NATO-geführten Mission, “Kosovo Force”, kurz “KFOR” genannt, arbeiten Soldat:innen aus verschiedenen Ländern in ganz unterschiedlichen Funktionen zusammen. Englisch ist oft die einzige gemeinsame Sprache, obwohl nur wenige sie als Muttersprache sprechen. Deswegen kommt es immer wieder zu Missverständnissen und Unklarheiten.
In meiner Bachelorarbeit habe ich untersucht, welche praktischen Herausforderungen sich wirklich durch den Gebrauch von Englisch als Lingua Franca (ELF) im militärischen Kontext ergeben und wie im Alltag damit umgegangen wird. Dafür habe ich das 51. Schweizer Kontingent der NATO-Mission im Kosovo, in welchem ich von Oktober 2024 bis April 2025 auch selbst im Einsatz war, zu ihren Erfahrungen befragt. Die Erkenntnisse zeigen, dass Kommunikation im Einsatz weit mehr ist als ein sprachliches Detail – sie ist ein entscheidender Faktor für Zusammenarbeit, Sicherheit und Effizienz.

Warum dieses Thema wichtig ist
Wer in einer internationalen Mission arbeitet, muss sich auf die Kamerad:innen verlassen können – unabhängig von Nationalität, Kultur oder Ausbildung. Sprache ist dabei das verbindende Element. Nicht nur verändert sich die Sicherheitslage auf der Welt in einem rasanten Tempo und betont die Wichtigkeit von guter, internationaler Zusammenarbeit. Die Schweiz hat auch einen verfassungsmässigen Auftrag, sich an der internationalen Friedensförderung zu beteiligen. Dies soll möglichst effi zient geschehen – und genau hier setzt meine Arbeit an.
Für meine Einsätze wurde ich in der Schweiz jeweils 2 bis 3 Monate ausgebildet, unter anderem auch in der standardisierten Kommunikation auf Englisch. Als ich jedoch im Einsatzraum dann mit anderen Nationen in Kontakt kam, merkte ich schnell, dass das Englisch-Niveau meiner internationalen Kamerad:innen nicht nur schlecht, sondern teilweise fast gar nicht vorhanden war. Starke Akzente, kulturelle Unterschiede im Kommunikationsstil, unsicherer Wortschatz oder Mehrdeutigkeit im Ausdruck führten in meiner Erfahrung schnell zu Missverständnissen. Oft wurde improvisiert: mit Gestik, Wiederholungen und Rückfragen, Online-Übersetzungstools. Das funktioniert im Alltag – kann aber in Stresssituationen, bei medizinischen Notfällen oder sicherheitskritischen Lagen zur echten Gefahr werden.
Dies erstaunte mich und gab mir schliesslich die Idee, den Gebrauch dieses Militär-Englischs im Einsatzalltag zu untersuchen.
Diese Realität war also der Ausgangspunkt meiner Untersuchung und stellte die Fragen: Welche Schwierigkeiten entstehen in diesem Kontext im Gebrauch von ELF? Wie wird in der Praxis damit umgegangen? Welche Ansätze und Instrumente gibt es schon, die zur effizienten Kommunikation beitragen, und was könnten weitere Lösungen dafür sein?

ELF im Militär – eine komplexe Standardsprache
Englisch als Lingua Franca ist im multinationalen Militärbetrieb längst etabliert. Ob NATO oder UN-Missionen – gemeinsame Einsätze wären ohne eine einheitliche Sprache kaum möglich. Dabei handelt es sich nicht um das Englisch von Muttersprachler:innen, oder eines wie wir es aus der Schule kennen, sondern um ein vereinfachtes, funktionales Englisch, das alle Beteiligten auf einem gewissen Niveau beherrschen, oder eben beherrschen sollten.
Doch dieser Ansatz hat Grenzen. Denn ELF in einem militärischen Kontext ist kein homogenes Sprachsystem, sondern ein Sammelbecken unterschiedlichster Ausdrucksformen – je nach Nation, Bildungshintergrund und Einsatzerfahrung. Hinzu kommen kulturelle Kommunikationsstile und unterschiedliche Ausbildungen im Vorfeld zur Mission. All das kann im Einsatz zu Unsicherheit, Missverständnissen oder sogar Fehlern führen.
Es existieren tatsächlich einheitliche militärische Standards wie beispielsweise das von der NATO erarbeitete STANAG 6001-Sprachprofi l, welches klare Vorgaben zu den sprachlichen Anforderungen einer Mission gibt. Es gibt standardisierte Funkprotokolle für Notfälle im Einsatz, doch wie konsequent sie geschult und angewendet werden, unterscheidet sich stark von Nation zu Nation. Obwohl sowohl die NATO sowie auch die UNO sogar ganze standardisierte Terminologie-Datenbanken erarbeitet haben, die in allen offi ziellen Sprachen der jeweiligen Organisation verfügbar sind, täuscht die formale Einheitlichkeit oft über die tatsächliche Vielfalt im Sprachgebrauch hinweg.
Meine eigenen Erfahrungen haben gezeigt, dass es oftmals Nuancen sind, die eine Stolperfalle in der Verständigung bilden können. Meist konnte ich mir selbst helfen, weil ich neben Englisch auch Italienisch spreche, was in meinem Fall sehr wertvoll war, denn die Region, wo ich stationiert war, stand unter italienischer Führung. Doch sobald weitere Nationen dazukamen, fand ich mich entweder in einer Übersetzungsfunktion, oder sehr bald verwirrt und uninformiert wieder. An den Gesichtern meiner Kamerad:innen konnte ich oftmals dasselbe ablesen: Pure Confusion.

Die Forschung – Stimmen aus der Praxis
Um ein möglichst realistisches Bild zu erhalten, habe ich eine qualitative Online-Umfrage im Kontingent 51 der Schweizer Armee durchgeführt, mit welchem ich auch selbst im Einsatz war. Von insgesamt über 200 Personen haben 60 schlussendlich an der Umfrage teilgenommen. Die Umfrage enthielt geschlossene, halb-offene sowie offene Fragen und wurde anschliessend inhaltlich analysiert und ausgewertet. Viele der Erfahrungen, die die Teilnehmenden geäussert haben, konnte ich direkt mit meinen eigenen vergleichen und so abgleichen, inwiefern sie sich deckten oder unterschieden.
Die Antworten waren eindrücklich und haben zusammengefasst folgendes aufgezeigt:
- Ein Grossteil der Teilnehmenden berichtete von konkreten Situationen, in denen Missverständnisse durch Sprache zu Verzögerungen oder fehlerhaften Abläufen führten. Oftmals wurde als Folge dieser Missverständnisse auch ein Mehraufwand genannt, weil Arbeiten erneut gemacht werden mussten.
- Häufig wurden für diese Herausforderungen pragmatische Lösungsstrategien beschrieben: wiederholen, vereinfachen, Körpersprache einsetzen, zur Not auf Google-Translate zurückgreifen oder einfach so lange umformulieren, bis das Gesagte verstanden wurde.
- Viele Befragte wiesen in dieser Hinsicht jedoch darauf hin, dass solche Lösungen meist nur unter normalen Bedingungen funktionieren. In Notfällen oder bei hoher Belastung und Stress sei das Risiko ungleich höher und könne je nach Situation schwere Folgen haben.
- Die Befragten haben mehrfach betont, dass institutionelle Massnahmen wie Sprachtrainings oder standardisierte Protokolle und Dokumente zwar hilfreich, aber nicht konsequent umgesetzt seien. Die Sprachvorbereitung auf einen solchen Auslandeinsatz variiere stark zwischen den Nationen und könne ausserdem kaum vorgängig kontrolliert werden.
- Trotz allen Schwierigkeiten ist sich die Mehrheit einig: die Hilfe von Übersetzer:innen ist für ihre Arbeit mit anderen Nationen nicht nötig. Nur im Austausch mit der Bevölkerung ist sie unumgänglich.
Insgesamt zeigt sich klar ein Spannungsfeld zwischen hoher individueller Anpassungsfähigkeit der Einsatzkräfte und strukturellen Lücken in der Ausbildung und Standardisierung. Viele Verständnisprobleme können zwar improvisiert gelöst werden, lassen aber ein grosses Risiko offen für Notfälle.
Sprache als Schlüssel und Stolperfalle
Die Arbeit macht deutlich: Englisch als Lingua Franca bildet die Grundlage multinationaler Zusammenarbeit – ist aber kein Garant für reibungslose Kommunikation. Sprachliche Hürden entstehen durch unterschiedliche Vorerfahrungen, nationale Ausbildungssysteme, kulturelle Eigenheiten und situativen Stress.
Gleichzeitig zeigt der Umgang der Schweizer Einsatzkräfte mit diesen Herausforderungen eine hohe Improvisationsfähigkeit und Anpassungsbereitschaft, was oftmals einen substanziellen Einfl uss auf die Arbeit verhindern kann. Doch darauf allein sollte man sich nicht verlassen: In kritischen Momenten kann ein Missverständnis schwerwiegende Folgen haben – insbesondere, wenn schnelle Entscheidungen getroffen oder präzise Befehle umgesetzt werden müssen.
Deshalb braucht es:
- Mehr realitätsnahe Kommunikationstrainings, die nicht nur Grammatik, sondern auch interkulturelle Verständigung üben.
- Regelmässige Feedbackschleifen im Einsatzraum, um Missverständnisse zu erkennen und voneinander zu lernen.
- Einheitliche Standards in der Sprachvorbereitung – und zwar nicht nur für Non-Native-Speakers, sondern auch für Muttersprachler:innen, die oft unbewusst zu hohes Tempo oder komplexe Ausdrücke verwenden.
- Kontrollorgane oder Verbindungsfunktionen vor Ort, die im Einsatzraum die Verständigung vereinfachen können.
Denn Sprache im militärischen Kontext ist mehr als nur ein Werkzeug – sie ist ein Schlüssel zur Zusammenarbeit und ein Risiko, das gesteuert werden muss. Wer sie unterschätzt, riskiert nicht nur Missverständnisse, sondern auch den Erfolg gemeinsamer Einsätze.

Zwischen Missverständnissen, Aha-Momenten und einem Hauch Google Translate
Am Ende dieser Arbeit bleibt vor allem eins: tiefer Respekt für alle, die sich tagtäglich durch ein sprachliches Minenfeld manövrieren – mit Kopfnicken, Körpersprache und gelegentlich mit der Hilfe von Google Translate. Wer denkt, dass Englisch als gemeinsame Sprache schon die halbe Miete ist, war wohl noch nie Teil einer multikulturellen Funkrunde mit fünf Nationen und sechs Dialekten.
Die grösste Herausforderung? Ganz klar: Die Balance zwischen wissenschaftlicher Analyse und dem Versuch, chaotische Einsatzrealitäten in saubere Kategorien zu pressen. Eigene Erfahrungen, Erwartungen und Annahmen auf eine sachliche Ebene zu bringen, fiel mir nicht immer ganz leicht. Aber es war genau diese Reibung, die den spannendsten Teil der Arbeit ausgemacht hat. Denn Sprache im Einsatz ist nicht linear, nicht perfekt – und oft genau deswegen so menschlich.
Das schönste Learning? Dass Kommunikation nicht nur über Grammatik funktioniert, sondern über Vertrauen, Humor und eine gewisse Fehlertoleranz. Und dass es manchmal mutiger ist, nachzufragen, als zu nicken und zu hoffen, dass schon nichts passiert.
Ich nehme mit, dass Sprache keine Nebensache ist. Sie ist das, was Teams im Einsatzraum verbindet – oder eben trennt. Und sie verdient viel mehr Aufmerksamkeit, wenn wir wollen, dass internationale Zusammenarbeit nicht nur irgendwie funktioniert, sondern gemeinsam gelingt.
Sprache, vor allem der effiziente Gebrauch davon, kann also ein entscheidender Faktor für den Frieden sein.

Weitere Beiträge aus dem Bachelor Mehrsprachige Kommunikation:
- Berufseinstieg in die Sprachbranche – Absolvent Alessandro Accetta im Porträt
- Mehrsprachige Kommunikation im Wandel: Neue Vertiefungen für ein zukunftssicheres Berufsfeld
- Zwei Welten, ein Ziel: Interdisziplinäre Zusammenarbeit in der App-Entwicklung
- Wie erreiche ich ein professionelles Sprachniveau?
- Politik für alle: Sind unsere Volksabstimmungen barrierefrei?
- Studierende arbeiten beim Übersetzen mit Kopf, Herz und KI
- Vom Studium in die Barrierefreie Kommunikation: Ein Alumniporträt
- Mit einer Sehbehinderung den Bachelor Mehrsprachige Kommunikation studieren? Das geht!