
Wie bereiten wir Studierende darauf vor, nicht nur Wissen zum Klimawandel zu erwerben, sondern es direkt anzuwenden?
Dies war eine der Fragen, die im Zentrum der Weiterentwicklung des Bachelorstudiengangs Umweltingenieurwesen stand. Unser Ziel war es, die Studierenden von Anfang an handlungsorientiert zu unterrichten und ihnen die Kompetenzen zu vermitteln, die sie brauchen, um aktiv zur Lösung von Umweltproblemen wie dem Klimawandel beizutragen.

«Ich bin überzeugt, dass Studierende nicht nur Fachwissen erwerben sollten, sondern auch gezielt Future Skills entwickeln müssen. Dazu gehören unter anderem strategisches Denken, systemisches Verständnis und die Fähigkeit, Probleme lösungsorientiert anzugehen. Dies erfordert kompetenz- und handlungsorientierte Lernsettings und -methoden.»
Danièle Lagnaz, Studiengangleitung BSc Umweltingenieurwesen
Das neue Studienmodell setzt ab dem ersten Semester auf Problem-Based Learning (PBL) und Project-Based Learning. In praxisnahen Projektmodulen bearbeiten die Studierenden aktuelle gesellschaftliche Herausforderungen: Klimawandel, nachhaltige Ernährungssysteme, Biodiversitätsförderung und Energiewende. Dabei lernen sie, vernetzt zu denken, verschiedene Perspektiven einzunehmen, ihre Positionen überzeugend zu vertreten und ihr Wissen direkt in Handlung umzusetzen.
Als Modulleiterinnen sind wir mit grossem Enthusiasmus die Herausforderung angegangen, ein Modul zum Klimawandel zu entwickeln und diese Ideen mit Leben zu füllen! Problembasierter Unterricht mit Handlungsorientierung im Zentrum für 155 Studierende? Challenge accepted!
Fokus des Moduls Klimawandel
Im Projektmodul „Klimawandel“ setzen sich die Studierenden mit den Verursachern und Folgen der Treibhausgasemissionen, mit möglichen Lösungsansätzen und mit der nationalen sowie internationalen Klimapolitik auseinander. Naturwissenschaftliche Grundlagen, etwa die Komponenten des Klimasystems und deren Wechselwirkungen, werden im parallel laufenden Modul «Chemie und Klimatologie» behandelt.
Stellungnahme und Debatte als praxisnahe Leistungsnachweise
Anstatt klassischer Prüfungen setzen wir auf praxisnahe und kompetenzorientierte Leistungsnachweise. Einer davon ist die politische Stellungnahme als Projektarbeit während des Semesters: Wir entwickelten ein fiktives CO2-Gesetz für die Zeit nach 2030 und simulierten eine Vernehmlassung. Die Studierenden schrieben Stellungnahmen aus der Perspektive verschiedener Akteure – von Umweltorganisationen über die Energiebranche bis zur Landwirtschaft. Sie begründeten ihre Positionen zu einzelnen Massnahmen mit konkreten Argumenten und schlugen alternative Massnahmen vor. Die inhaltlichen Aspekte diskutierten sie in Seminaren in kleinen Gruppen. Ergänzend dazu legten wir besonderen Wert auf ein gezieltes Argumentationstraining.
Der zweite Leistungsnachweis war eine Debatte. In 16 Gruppen traten Studierende in Pro- und Contra-Teams gegeneinander an und diskutierten die Frage: Soll die Schweiz ihre CO2-Reduktion ausschliesslich im Inland leisten? Dabei mussten sie nicht nur ihre Argumente und Gegenargumente strukturiert, überzeugend und klar formulieren, sondern auch auf ihre Körpersprache und auf paraverbale Aspekte wie ihre Stimme achten.
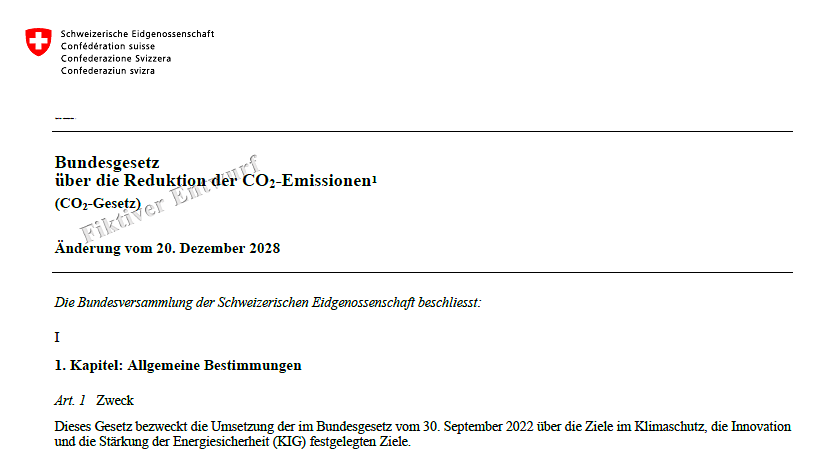
ㅤ
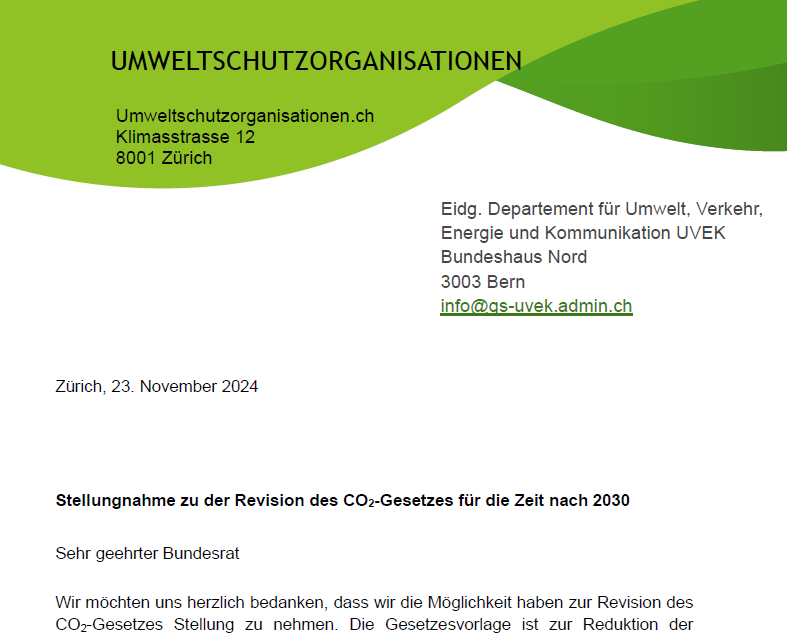
ㅤ
Blick in die Praxis: Exkursionen
Neben den Vorlesungen sowie den problem- und projektbasierten Lehrmethoden bot eine Exkursion den Studierenden die Gelegenheit, theoretisches Wissen mit Einblicken in die Praxis zu verknüpfen. Fünf Themenschwerpunkte standen zur Auswahl und ermöglichten u.a. mit Expert:innen vor Ort über Anpassungsmassnahmen und Projekte zur Minderung des Treibhausgasausstosses in der Stadt, die Partizipation von Einwohner:innen in einer Gemeinde, klimafreundliche Gemüseproduktion und landwirtschaftliche Biogasanlagen oder über Hochwasserschutz kombiniert mit Biodiversitätsförderung zu diskutieren.

ㅤ
Herausforderungen und Erfolgsmomente
War die erste Durchführung des Moduls ein voller Erfolg? Nicht alles lief reibungslos – und das war zu erwarten. Man muss sich bewusst sein, dass die Bewertung solcher Leistungsnachweise intensiv ist – gut durchdachte Bewertungsraster sind entscheidend, um den Aufwand in einem vertretbaren Rahmen zu halten. Besonders die Gestaltung der Debatten stellte eine Herausforderung dar: Wie stellen wir sicher, dass alle Studierenden zu Wort kommen, und trotzdem eine gewisse Dynamik in der Diskussion ermöglicht wird? Zudem brauchte es auch etwas Überzeugungsarbeit, dass Studierende im ersten Semester ihres Studiums eine solche Debatte meistern können.
Trotz dieser Herausforderungen überwiegt bei uns die Begeisterung. Gibt es Verbesserungspotenzial? Natürlich! Wir freuen uns darauf, das Modul weiterzuentwickeln und mit der nächsten Studierendengeneration weiterzuführen!
ㅤ
Über die Autorinnen:
Tetiana Kaufmann ist Mitglied des Teams Studiengangleitung BSc Umweltingenieurwesen. Sie leitet Entwicklungsprojekte in der Lehre am Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen und hat die Weiterentwicklung des BSc Umweltingenieurwesen mitgeprägt. Sie ist Co-Modulleiterin des Moduls Klimawandel.
Monika Hutter ist wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Forschungsgruppe Hortikultur und Studienberaterin im BSc Umweltingenieurwesen. Sie hat am Institut für Umwelt und Natürliche Ressourcen (IUNR) beim Handlungsfeld Netto Null mitgewirkt und zusammen mit dem Team die Integration des Themas Klimawandel ins weiterentwickelte Curriculum vorangetrieben. Sie ist Co-Modulleiterin des Moduls Klimawandel.